Die Corona-Krise und die Flüchtlingsbewegungen haben die Welt und unseren Kontinent fundamental verändert. Was bleibt noch vom Traum eines offenen Europas?
Kennen Sie das Spiel? Man nehme einen Stift und ein Stück leeres Papier, dann schließe man die Augen und zeichne die Umrisslinien des eigenen Landes. Im Falle Österreichs erscheint das noch recht einfach. Ein schmaler Korridor im Westen geht nach Osten hin in einen dicken Bauch über. Auch Italien ist machbar: ein Stiefel, von Meer umgeben. Aber wie genau sind die Grenzlinien am Balkan zu ziehen, oder im nordöstlichen Europa: etwa zwischen Polen, Weißrussland und Litauen?
Kaum jemand ist imstande, sich Ländergrenzen präzise einzuprägen, geschweige denn sie mit geschlossenen Augen verlässlich aufs Papier zu bringen. Aber müssen wir uns europäische Grenzen wirklich einprägen? Bis vor kurzem vielleicht nicht. Denn wer innerhalb des Schengen-Raums von einem Land ins andere reiste, merkte den Grenzübertritt kaum. Inzwischen hat sich das geändert, und zwar fundamental. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass die scheinbar so durchlässigen europäischen Grenzen über Nacht dichtgemacht wurden. Wir sind wieder ins Zeitalter der Schlagbäume, der Grenzzäune aber auch der nationalen Einigelung eingetreten.
Im März 2020 haben viele Staaten ihre Grenzübergänge geschlossen, um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen. Heute, Monate später, sind manche Grenzen wieder offen, andere halb offen, wieder andere sind noch oder neuerlich abgeriegelt. Wer ins Ausland reist, reist oft ins Ungewisse. Innerhalb der EU sind die Ein- und Ausreisebedingungen höchst unterschiedlich, außerhalb der EU vollkommen unübersichtlich. Fernreisen sind immer noch nicht angezeigt, denn es ist unklar, ob man auch wieder zurückkommt.
Geplatzte Träume
Dieser "Fleckerlteppich" an Grenzbestimmungen kam ziemlich unerwartet. Noch vor einem Dreivierteljahr schien, zumindest auf dem Papier, Europa, oder genauer: der Schengenraum, als halbwegs grenzenloser Raum - zumindest für EU-Bürger. Inzwischen hat sich das geändert. Der Traum vom grenzenlosen Europa ist geplatzt.
Das Ausnahmejahr 2020 hat etwas offenkundig gemacht, das sich schon seit längerem abzeichnete und spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 Konturen annahm: Ein neues, national und teils auch nationalistisch geprägtes Europa trat an die Stelle eines dem Anspruch nach übernationalen, grenzenlosen Europas. Abschottung trat an die Stelle von Öffnung. Kaum jemand hätte in der Blütezeit der österreichischen Europa-Euphorie der 1990er Jahre, als das Land der EU (1995) und wenig später dem Schengenraum (1998) beitrat, prophezeit, dass die Grenzen zu den Nachbarländern wieder geschlossen werden. Manch einer träumte davon, dass es künftig in Europa gar keine Grenzübergänge mehr geben würde, dass der Weg vom alten, national geprägten Staatenbund zum europäischen Bundesstaat unumkehrbar sei. Heute wissen wir: Es ist ganz anders gekommen.
Die ungewisse Gegenwart regt dazu an, Fragen zu stellen, die wir in den letzten Jahren nicht gestellt haben: Kommen wir überhaupt ohne Grenzen aus? Wie hat sich der Begriff der Grenze überhaupt entwickelt? Waren die fortschrittsoptimistischen Jahrzehnte nach 1945, in denen der Traum eines grenzenlosen Europas Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt näher zu rücken schien, nur eine kurze utopisch angehauchte Episode?
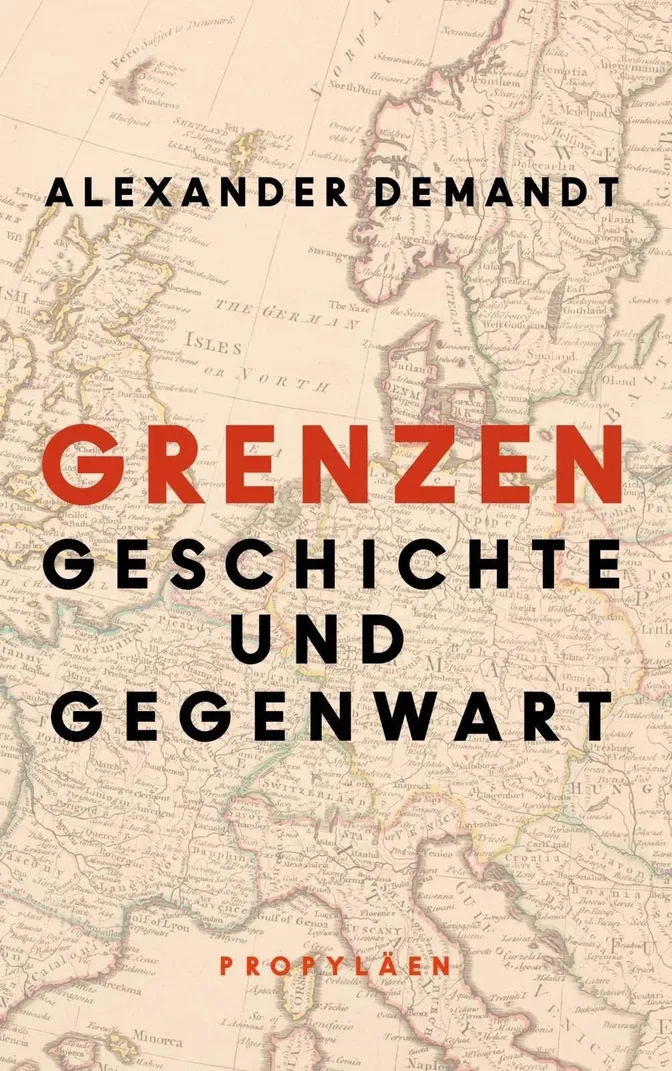
Als der französische Historiker Lucien Febvre (1878-1956) sich in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Gedanken über den Begriff der Grenze zu machen begann, rührte er in einer offenen Wunde. Der Grenzkonflikt zwischen Frankreich und Deutschland, der noch wenige Jahre zuvor mit den Waffen ausgefochten worden war, war nach 1918 keineswegs gelöst. 1928 formulierte Febvre seine Überlegungen in einem Aufsatz mit dem Titel "Frontière. Wort und Bedeutung", drei Jahre später erschien sein bahnbrechendes Werk über die Geschichte des Rheins, das im Kern um die Frage kreiste, welche Rolle dieser Fluss als Grenzmarkierung spielt.
Historisch gewachsen
Bildete er, wie viele behaupteten, eine "natürliche" Grenze, war er ein französischer Strom oder ein deutscher? Weder noch, war die klare Antwort des Historikers. Die Rolle des Rheins bestand und besteht, so führte er aus, in seiner Brückenfunktion, in seiner Rolle "zu verbinden und anzunähern". Ein unerhörter Gedanke für die Nationalisten auf beiden Seiten, die ihre offensiven Gebietsansprüche mit dem Argument der "natürlichen" Grenzen rechtfertigten.
Gibt es überhaupt "natürliche" Grenzen? Sind die Pyrenäen, sind die Alpen, sind Küstenlinien "natürliche" Grenzen? "Nein!", sagt der französische Historiker. Es handelt sich in allen Fällen um historisch gewachsene Grenzen. "Natürliche" Grenzen seien etwas für "Schlaumeier oder Einfaltspinsel". Auch Küstenlinien, Flussläufe oder Bergrücken, die Grenzverläufe "natürlich" erscheinen lassen, seien historisch entstanden und auch veränderbar. Am Beispiel des Rheins führt er aus, wie irreführend es ist, wenn man die Grenze auf die schmale Trennlinie zwischen zwei Staaten reduziert, ein Konzept, das erst in der Neuzeit allmählich entstanden sei.

Stattdessen verortet Febvre das Konzept der Grenze jenseits der nationalen Geschichtsschreibung, im Kontext der europäischen Sozial- und Kulturgeschichte. Der antinationalistische und antirassistische Fokus des Werks von Lucien Febvre musste in den 1930er Jahren, als die nationalstaatlichen Grenzen zwischen Frankreich und Deutschland wieder zur Konfliktzone wurden, als Provokation aufgefasst werden. In Frankreich, aber vor allem auch in Deutschland, das sich anschickte, zur nationalsozialistischen Diktatur zu werden. Kein Wunder, dass das Buch erst über ein halbes Jahrhundert später, 1994, in einer deutschsprachigen Fassung erschien. Es lohnt, Febvres Überlegungen heute, in dem von neuen Grenzen heimgesuchten Europa, wieder zu lesen.
Grenzen, so die Quintessenz der Überlegungen von Lucien Febvre, verstehen wir nicht, wenn wir uns nur vor Ort umsehen. Weder die charakteristischen Formen der Landschaft (Flussläufe, Berge, Küsten) geben vor, wie Grenzen bestimmt werden, noch sprachliche, ethnische oder soziale Übergänge. Wenn wir die Grenze verstehen wollen, müssen wir uns, so Febvre, dem Staat zuwenden.
Hüben und drüben
Erst als dieser stark und modern genug war, war er imstande, rund um sein nationales Territorium klare Grenzlinien zu ziehen und zu verteidigen. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war die Grenze noch ein recht diffuses Konzept, um Herrschaft zu begrenzen. Befestigungsanlagen markierten damals noch nicht ein homogenes, linear begrenztes Territorium, sondern waren Pflöcke der Macht, die nicht selten Enklaven im gegnerischen Einflussbereich schützten.

Erst der moderne Nationalstaat, der seine Herrschaft nach innen wie nach außen ausbaute, brauchte scharf gezogene Grenzen, die nun auch vermessen, gekennzeichnet und geschützt wurden. Seit der Französischen Revolution, so Febvre, ist die Grenze der "auf die Erde projizierte Außenumriss einer ihrer selbst völlig bewußten Nation". Neu ist, so der französische Historiker, dass dieser neue nationale Umriss des Nationalstaats nun auch zur moralischen Grenze wird, zu einer Demarkationslinie, "die sich rasch mit allem Haß, aller Rachsucht und allen Schrecken belud". In Kriegszeiten ist diese Dimension offensichtlich: Grenzen werden zu "heiligen" Orten, ihre unbefugte Überschreitung oder Verletzung zu Akten der Barbarei. Aber nicht nur in Zeiten des Krieges ist die Grenze eine hoch emotionalisierte Projektionsfläche. Ein Angriff auf die Grenze wird auch in Friedenszeiten häufig als Angriff auf den "Körper" des eigenen Staates aufgefasst, auf seine Ehre und seine Würde.
Aus diesem Grunde sind alle Debatten um die "Unverletzlichkeit" der Grenzen auch zutiefst emotionale Debatten, die weit über reise-, zoll- und neuerdings gesundheitstechnische Aspekte hinausgehen. Es ist das Verdienst des französischen Historikers, zum ersten Mal auf diese komplexen Dimensionen der Grenzwahrnehmung hingewiesen zu haben. Die Wirklichkeit der Grenzen ist für den Nationalisten sehr einfach: hüben wir, drüben die anderen. Tatsächlich aber, so Lucien Febvre, sind die Grenzen und ihre Geschichte "unendlich kompliziert".

Wie komplex und vielschichtig das Thema der Grenze ist, lässt sich auch in der eben erschienenen Studie "Grenzen - Geschichte und Gegenwart" des deutschen Althistorikers Alexander Demandt nachlesen (Propyläen Verlag, Berlin 2020, 28,80 Euro). In einem beeindruckenden zeitlichen und geografischen Bogen, der von der Frühgeschichte über die Antike bis in die Gegenwart führt, geht er den vielfältigen Bedeutungsveränderungen der Grenzkonzepte nach. Er zeigt, wie zentral die Ziehung von Grenzlinien für die Weiterentwicklung vieler Gesellschaften war; er erzählt aber auch, wie in der Neuzeit Grenzen häufig zu konfliktbeladenen "Macht- und Unrechtsgrenzen" wurden, um die nicht selten Kriege geführt wurden.
Als 2015 die europäischen Flüchtlingsbewegungen einige Monate lang fast unkontrolliert nationale Grenzen überschritten, machte sich vielerorts ein Gefühl der Ohnmacht, der Bedrohung und des Ausgeliefertseins breit. In der Sprache der Bürokratie ist im Jahr 2015 ein neuer Begriff aufgetaucht: "Grenzmanagement".
"Festung" Europa
Was ist darunter zu verstehen? In gewisser Weise die Quadratur des Kreises: Wie schafft man es, zuallererst den binneneuropäischen Warenverkehr nicht zu stören? Sodann EU-Bürger und Touristen möglichst unbehelligt durch Europa zu befördern? Und schließlich zielsicher jene Personengruppen an den reaktivierten nationalstaatlichen Grenzübergängen zu unterscheiden, die Asylrecht bekommen, und jene, die draußen bleiben sollen? Migranten, die aus unterschiedlichen Gründen im reichen Europa Zuflucht suchen. Damals wurde in Österreich heiß debattiert, wie das Nadelöhr in Spielfeld, am Brenner und anderswo beschaffen sein müsse, um dem Ansturm der Fremden gerecht zu werden und zugleich den täglichen Personen- und Warenverkehr zu managen. Neuartige Grenzsicherungssysteme wurden erdacht, Zäune und Türen ins Spiel gebracht. Nicht als durchgehenden "Zaun" - so wie in Ungarn - wollte der damalige Kanzler Werner Faymann die Bauarbeiten an den Grenzstationen bezeichnet wissen, sondern als "Türl mit Seitenteilen".

Tatsächlich wurden auch in Österreich Zäune gebaut, freilich nicht so lange und durchgehende wie an Ungarns südlicher Grenze, wo im Sommer 2015 zunächst die Grenze zu Serbien und später auch jene zu Kroatien und Slowenien durchgehend abgeriegelt wurde. In der europäischen Öffentlichkeit wurde dieser Zaun scharf kritisiert. Die hermetische Schließung der Grenze mittels Stacheldraht wurde als nationalistischer Angriff auf die gesamteuropäische Solidarität und eine humanistische Lösung der Flüchtlingskrise gesehen. Aber die Abriegelung Europas und die Verwandlung des Kontinents in eine "Festung" hat nicht erst 2015 in Ungarn, sondern schon lange vorher begonnen. Die beiden spanischen Enklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla, wurden schon vor 20 Jahren mit meterhohen Zäunen gegen den Flüchtlingsansturm geschützt. An der türkischen Grenze begann Griechenland 2012 mit dem Bau eines Grenzzauns, an der bulgarisch-türkischen Grenze wurde 2014 mit dem Bau eines Zauns begonnen. Inzwischen wurden in zahlreichen weiteren mittel- und südosteuropäischen Ländern Grenzzäune errichtet.
Umrisslinie im Kopf
Die jüngste Absperrung ist noch im Bau: Im Sommer 2020 begann Serbien an der Grenze zu Nordmazedonien mit dem Bau eines Zaunes. Je dichter und höher die Zäune am europäischen Festland wurden, desto mehr haben sich die Fluchtrouten in Richtung Mittelmeer verschoben, wo es bisher keine Zäune gibt. Aber auch dort wurden in den letzten Jahren neue Grenzen errichtet, die mit Patrouillenbooten gesichert werden. Wer diese Grenze überwindet, landet auf Lesbos, Samos, Chios oder Kos, wo der Traum vom besseren Leben in Europa endet - unter menschenunwürdigen Bedingungen, wie die Bilder aus dem Lager Moria auf Lesbos zuletzt zeigten.
Aber nicht nur in den Randzonen Europas werden Grenzen hochgezogen, auch bei uns werden sie befestigt, real und in den Köpfen. Wen hätte in der Europa-Euphorie der 1990er Jahre interessiert, dass Österreich eine exakt 2.706 Kilometer lange Außengrenze hat, wenn doch gerade erst die Übergänge nach Europa geöffnet wurden? Zwei Jahrzehnte später, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsströme, besann man sich dieser Umrisslinie wieder. Politiker führten ins Treffen, dass man diese lange Grenze nicht durchgehend befestigen könne. Tatsächlich führt die Grenze des Alpenstaates nicht nur über ebene Felder, sondern über Stock und Stein, über schwer begehbare Gipfel und über das Wasser des Bodensees, der bei der Berechnung der Außengrenze üblicherweise nicht mitgerechnet wird.
Defensives Gebilde
Denn auf diesem Binnengewässer wurden die staatlichen Grenzen kurioserweise nie festgelegt, dieses "Niemandswasser" gehört seit der Mitte des 17. Jahrhunderts allen Anrainerstaaten und zugleich keinem von ihnen. Auf festem Boden ist die Grenzlinie durchgehend markiert, und zwar durch rund 27.000 Grenzzeichen sowie durch "40.000 unvermarktete Bruchpunkte", wie es in der Amtssprache heißt. Ist es Zufall, dass sich just in der Phase, da die nationalen Begrenzungen wieder zunehmend ins Blickfeld geraten, sportliche Unternehmungen genau entlang dieser Grenzen häufen? Wohl kaum.
Am 31. Mai 2014 starteten die beiden Bergsteigerinnen Gertrude Reinisch-Indrich und Christine Eberl ihre "Grenzgänge rund um Österreich". Monatelang folgten sie so präzise wie möglich dem Grenzverlauf und umrundeten im Sommer 2014 und 2015 in insgesamt 143 Wander- und Klettertagen (und 18 Rasttagen) das gesamte Land, ohne je einen Fuß ins Ausland gesetzt zu haben. Wenige Jahre zuvor, 2009, war zum ersten Mal das "Race Around Austria" durchgeführt worden. Auch dieses sportliche Projekt lebt vom Gedanken, nur die Wege entlang der Grenzen zu nehmen und keinen Abstecher ins Ausland zu machen. Nach dem Start läuft die Zeit unaufhaltsam. Es gibt keine Etappeneinteilung, kein Ausruhen in der Nacht, jeder Stopp muss sorgfältig geplant und wieder aufgeholt werden.
Im Sommer 2020 fand die vorerst letzte Ausgabe dieses Extremrennens statt. Zum vierten Mal fuhr Christoph Strasser als Sieger über die Ziellinie. Die 2.200 Kilometer lange Strecke, die mehr als 30.000 Höhenmeter überwindet, hatte er in drei Tagen, elf Stunden und 26 Minuten absolviert - ein neuer Rekord. Am Beispiel solcher Österreichumrundungen wird deutlich, dass die Grenze nicht nur eine politische und neuerdings gesundheitliche Dimension hat, sondern längst in der Populärkultur und im Sport angekommen ist.
Der Historiker Lucien Febvre hat eindrucksvoll gezeigt, dass Grenzen, um wirksam zu sein, sichtbar gemacht und markiert werden müssen. Sie werden nicht nur bewacht, sondern auch besprochen, abgebildet, bereist und erwandert. Auf diese Weise werden sie in Kopf und Körper verankert. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren erlebt, wie dieser Prozess des Grenzenziehens an Fahrt aufgenommen hat.
Der Traum vom grenzenlosen Europa scheint vorerst ausgeträumt. An seine Stelle ist das Bild des Bollwerks getreten, eines defensiven Gebildes, das aus der Summe einzelner befestigter Nationalstaaten besteht. Soll das so bleiben?
Anton Holzer, geboren 1964, ist Fotohistoriker, Publizist, Ausstellungskurator und Herausgeber der Zeitschrift "Fotogeschichte".
www.anton-holzer.at